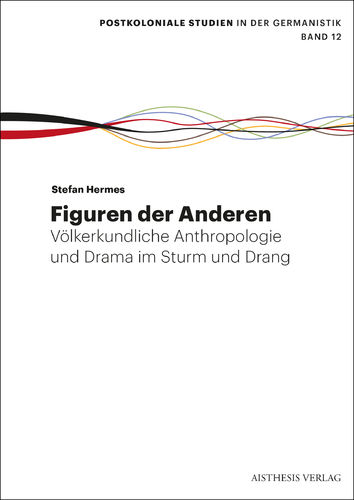| Inhalt |
- I. Zur Einführung
- I.1. Der Sturm und Drang in interkultureller Perspektive?
Inszenierungen kultureller Differenz als Desiderat der Sturm-und-Drang-Forschung ▪ Zu den Hauptmerkmalen und zur Periodisierung des Sturm und Drang ▪ Der kulturhistorische Kontext: Nationendiskurs und ,zweites Entdeckungszeitalter‘ ▪ Textauswahl und Gang der Untersuchung
- I.2. Theoretische Zugänge. Literarische Anthropologie, interkulturelle und postkoloniale Literaturwissenschaft
Literarische Anthropologie als Forschungsperspektive ▪ Die bisherige Schwerpunktsetzung der literarischen Anthropologie ▪ Zum Begriff der völkerkundlichen Anthropologie ▪ Interkulturalitätsforschung und postkoloniale Theorie als ergänzende Perspektiven ▪ Literarische Anthropologie und Drama
- II. Europäische Völkervielfalt. Nationendiskurs und Anthropologie im Sturm und Drang
- II.1. Differenzkonstruktionen. Der Diskurs des deutschen Frühnationalismus
Zu den Anfängen des deutschen Nationalismus ▪ Nationales Denken im Vorfeld des Sturm und Drang ▪ Ästhetischer Nationalismus? Justus Möser vs. Friedrich II. ▪ Das anthropologische Konzept des Nationalcharakters ▪ Zur völkerkundlichen Anthropologie des jungen Herder ▪ Die politischen Implikationen von Herders völkerkundlicher Anthropologie ▪ Herders Wirkung auf seine Zeitgenossen
- II.2. Differenzinszenierungen. Entwürfe europäischer Nationalcharaktere im Drama des Sturm und Drang
- II.2.1. Kampf der Kulturen? Deutscher und französischer Nationalcharakter bei Lenz (und Klinger)
Kulturelle Differenz als Element von Lenz’ Lebenswelt(en) ▪ Sprache, Literatur und Nation in Lenz’ theoretischen Schriften ▪ Wider die ,deutschen Franzosen‘. Das Pandämonium Germanikum ▪ Die bisherige Forschung zu Lenz’ Literatursatire ▪ Nationale Identität und kulturelle Hybridität ▪ Zur sprachlichen Gestaltung des Pandämonium Germanikum ▪ Die gängigen Lesarten von Lenz’ Die Soldaten ▪ Kulturelle Differenz in den Soldaten ▪ Mimikry als Element von Lenz’ Gesellschaftskritik ▪ Zur hybriden Struktur der Soldaten: Gattungspoetik und Intertextualität ▪ Exkurs: Kulturelle Differenz und Mimikry in Klingers Die falschen Spieler
- II.2.2. Ein Deutscher unter Spaniern (und Franzosen). Lenz’ Die Freunde machen den Philosophen
Gallophobe Tendenzen in Lenz’ Drama ▪ Bildungsreise und Heimatflucht. Der Protagonist im spanischen Exil ▪ „Ich bin ein Fremder“. Zum Außenseiterstatus der Strephon-Figur ▪ Die Verschränkung von Europa- und Überseediskurs ▪ Sprachliche Hybridität und Intertextualität
- II.2.3. Invertierte Stereotype? Franzosen und Spanier in Goethes Clavigo
Spanien als Dramenschauplatz beim jungen Goethe ▪ Ein französischer ,Wilderʻ? Die Beaumarchais-Figur ▪ „[V]on den Canarischen Inseln“. Zum Titelhelden des Clavigo ▪ Zur dreifachen Alterität der Marie-Figur ▪ Jenseits der Nationalstereotype und -literaturen
- II.2.4. Melancholia anglica in Italien. Lenz’ Der Engländer
Geniekult und Anglophilie im Sturm und Drang ▪ Die ,englische Krankheit‘: Melancholie und Suizidalität ▪ Exkurs: Zur prekären ,Englishness‘ der Lady Milford in Schillers Kabale und Liebe ▪ Heimatflucht und Daseinsekel in Lenzʼ Der Engländer ▪ Anthropologie im Medium des Dramas ▪ Der Engländer im Kontext der bislang untersuchten Stücke
- III. Nahe Fremde. Juden- und ,Zigeuner‘-Figuren im Sturm und Drang
- III.1. Exklusionsstrategien. Der deutschsprachige Diskurs um die Juden
Die aschkenasischen Juden als ,nahe Fremde‘ ▪ Gottesmörder und Wucherer. Zum frühneuzeitlichen ,Wissen‘ über die Juden ▪ Die allmähliche Säkularisierung der ,Judenfrage‘ im 18. Jahrhundert ▪ Vom religiösen Furor zur frühen Völkerkunde: Eisenmenger und Schudt ▪ Weitere Stationen der völkerkundlich-anthropologischen Debatte um die Juden ▪ Akkulturations- und Emanzipationsbestrebungen der frühen Haskala ▪ Reaktionen aus der Mehrheitsgesellschaft ▪ Exkurs: Kants und Herders Auseinandersetzung mit dem Judentum ▪ Judentum und deutschsprachige Literatur im 18. Jahrhundert (Gellert, Lessing)
- III.2. Prekäre Existenzen. Juden im Drama des Sturm und Drang
- III.2.1. Zwischen Geschichte und Gegenwart. Juden beim jungen Goethe
Das Judentum in Goethes Frühwerk ▪ Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern als poetologische Farce ▪ Ein jüdisches Spiel im Spiel. Goethes Adaption der Esther-Geschichte
- III.2.2. Täter und/oder Opfer? Juden bei Lenz, Wagner und Müller
Lenz’ physiognomische „Bemerkung“ über die Juden ▪ Der Jude als Finanzjongleur. Zu Lenz’ Die Türkensklavin ▪ Exklusion und Komik in Lenz’ Soldaten ▪ Ein nahezu vergessenes bürgerliches Trauerspiel. Wagners Die Reue nach der That ▪ Physiognomik und Melancholie-Diskurs bei Wagner ▪ Wagners Mitleidsästhetik. Der Jude als Opfer und Außenseiter ▪ Werkzeuge des Teufels? Die Judenfiguren in Müllers Fausts Leben
- III.2.3. Ein jüdischer Bandit? Zur Spiegelberg-Figur in Schillers Die Räuber
Die Räuber als anthropologisches Drama ▪ Jüdische Themen bei Schiller. Zur bisherigen Forschung ▪ Spiegelbergs hybride Identität I. Direkte Bezugnahmen auf das Judentum ▪ Spiegelbergs hybride Identität II. Jüdische Charakterzüge?
- III.3. ,Wilde‘ auf deutschem Boden? Der Diskurs um die ,Zigeuner‘
Zur diskursiven Konstruktion der ,Zigeuner‘ ▪ Legenden und Gerüchte. Das ,Wissen‘ von den ,Zigeunern‘ ▪ Die ,Zigeuner‘ bei Thomasius und im Zedler ▪ Vermeintliche Verwandtschaften: ,Zigeuner‘, Juden, ,Wilde‘ ▪ ,Zigeuner‘-Figuren in der (deutschsprachigen) Literatur
- III.4. An den Rand gedrängt. ,Zigeuner‘ im Drama des Sturm und Drang
- III.4.1. Zwischen Idealisierung und Kriminalisierung. ,Zigeuner‘ beim jungen Goethe
Götz von Berlichingen als vaterländisches Drama ▪ Ein fremdes ,Naturvolk‘. Die ,Zigeuner‘ in der Geschichte Gottfriedens ▪ Devote Banditen. Die ,Zigeuner‘ im Götz von Berlichingen ▪ Exkurs: Die ,Zigeuner‘ im Jahrmarktsfest zu Plundersweilern
- III.4.2. Die ,Zigeunerin‘ als altes Weib bei Klinger und Lenz
Die Hexe im Wald. Zur ,Zigeunerin‘ in Klingers Otto ▪ Eine antiziganistische Karikatur? Die Feyda-Figur in Lenz’ Türkensklavin
- IV. Ferne Völker. Exotismus und Anthropologie im Sturm und Drang
- IV.1. Europa ist nicht die Welt. Der exotistische Diskurs im (ausgehenden) 18. Jahrhundert
Der Sturm und Drang und das außereuropäische Fremde ▪ Die (faktuale) Reiseliteratur der Aufklärung ▪ Reiseliteratur und völkerkundliche Anthropologie. Die ,Rassenfrage‘ bei Linné, Buffon, Kant, Blumenbach und Lavater ▪ Kulturelle Differenz als ,Ungleichzeitigkeit‘. Die ,Geschichte der Menschheit‘ ▪ Zum Orientalismus der Aufklärung I. Kulturkontakte und Reiseliteratur ▪ Zum Orientalismus der Aufklärung II. Völkerkundliche Anthropologie und fiktionale Literatur ▪ Der Diskurs um die ,Wilden‘ Amerikas I. Kulturkontakte und Reiseliteratur ▪ Der Diskurs um die ,Wilden‘ Amerikas II. Völkerkundliche Anthropologie und fiktionale Literatur ▪ Das glücklichste Volk auf Erden? Die ,Entdeckung‘ der Tahitianer ▪ Der ,Wilde‘ als Typus (Montaigne, Rousseau, Herder) ▪ Von ,Mohren‘ und ,Negern‘ ▪ Der Diskurs um die Afrikaner I. Kulturkontakte und Reiseliteratur ▪ Der Diskurs um die Afrikaner II. Völkerkundliche Anthropologie und fiktionale Literatur
- IV.2. Jenseits der ,Zivilisation‘? ,Orientalen‘ und ,Mohren‘ im Drama des Sturm und Drang
- IV.2.1. Kulturkritik in morgenländischem Gewand. (Pseudo-),Orientalen‘ bei Lenz und Klinger
Einführender Exkurs: ,Exoten‘ im Frühwerk von Goethe und Lenz ▪ Ein ,Orientale‘ als ,edler Wilder‘? Zu Lenzʼ Der neue Menoza ▪ Identitätswirren und Aufklärungskritik ▪ Zur völkerkundlich-anthropologischen Unbestimmtheit der Tandi-Figur ▪ Soziales Durcheinander und gender trouble ▪ Europäische Lasterhaftigkeit ▪ Kulturelle und ästhetische Hybridität im Neuen Menoza ▪ Der Mittelmeerraum als contact zone. Zu Lenzʼ Freundschaft geht über Natur ▪ Völkerkundlich-anthropologische Aspekte in Lenz’ Die Christen in Abyssinien ▪ Nichts als Barbaren? Die ,maurischen‘ Figuren in Klingers Simsone Grisaldo ▪ Bemitleidenswerte Gestalten. Die kastilischen Nebenfiguren ▪ Der Feind als Doppelgänger. Klingers Titelheld und sein ,maurischer‘ Gegenpart ▪ Morgenländische Phantasien. Klingers Der Derwisch und Prinz Seidenwurm ▪ Ein orientalisierendes Textlabyrinth. Lenz’ Myrsa Polagi
- IV.2.2. Der ,Mohr‘ als Grenzgänger. Die Figur des Muley Hassan in Schillers Fiesko-Drama
,Exoten‘ im Werk Schillers ▪ Der ,Mohr‘ im Fiesko als ,unedler Wilder‘? ▪ Zur Komplexität der Muley-Hassan-Figur ▪ Die Funktionen des ,Mohren‘ im Fiesko
- IV.2.3. „[W]ir Schwarzen lernen weinen gar früh von Euch“. Die Sklaven-Figur in Klingers Sturm und Drang
Zum deutschsprachigen Nordamerika-Diskurs im ausgehenden 18. Jahrhundert ▪ Ein neues Leben in der ,neuen Welt‘? Zum Schauplatz von Sturm und Drang ▪ Vom Objekt zum Subjekt? Klingers Gestaltung der Sklaven-Figur
- V. Resümee
Literaturgeschichtsschreibung und interkulturelle Literaturwissenschaft ▪ Interkulturelle Dimensionen der Sturm-und-Drang-Dramatik
- VI. Literaturverzeichnis
Primärliteratur ▪ Sekundärliteratur
- VII. Namenregister
|
| Aus der Kritik |
[...] der Verdienst von Hermes' Buch liegt [...] auf der Vermittlung der Einsicht in die Wurzeln kolonialen Denkens, das keinesfalls erst mit der Erfahrung des „Exotischen“ anfängt. [...] [Eine] Fülle von positiven Eindrücken [...], die man vom präsentierten Material, seiner Organisation und der (Neu-)Interpretation bekommt.
Tomasz Waszak in „Acta Geremanica“ (Vol. 49, 2021)
Seine instruktiven Studien wecken hoffentlich das Interesse der historisch ausgerichteten literarischen Anthropologie für völkerkundliche Aspekte und das der Postcolonial Studies für literaturhistorische Fragestellungen. Für einen Zusammenschluss dieser beiden Perspektiven hat Hermes ein ausgezeichnetes Plädoyer geliefert und einen in vielerlei Hinsicht prekären Gegenstand, dem die Philologie sich weiterhin wird widmen müssen. Für die Epoche des Sturm und Drang ist jedenfalls ein erster, beeindruckender Schritt getan.
Manuel Zink in „Zeitschrift für Germanistik“ (Neue Folge XXXII / 2022)
Als ausgezeichneter Ansatz erweist sich die Zuordnung der ›Figuren der Anderen‹ zu drei unterschiedlichen Gruppen, die trotz der gleichen anthropologischen Grundannahmen jeweils eine andere, eigene Geschichte haben. Diese Typologisierung hilft dabei, das Repertoire der Aus- und Abgrenzungen an der Schwelle zum rassistischen Denken in der Moderne besser und genauer zu beschreiben. Das Buch von Stefan Hermes ist auch deshalb ein wichtiger und anregender Beitrag zur Literaturgeschichte, zur Sturm-und-Drang-Forschung und zur interkulturellen Literaturwissenschaft.
Klaus-Michael Bogdal in „Goethe-Jahrbuch“ (2021)
In seiner 2021 im Aisthesis Verlag in der Reihe „Postkoloniale Studien in der Germanistik“ veröffentlichten Habilitationsschrift Figuren der Anderen. Völkerkundliche Anthropologie und Drama im Sturm und Drang analysiert Stefan Hermes die Inszenierung kultureller Differenz in der Literatur des Sturm und Drang und leistet somit einen interdisziplinären Beitrag zur Literaturgeschichtsschreibung und Interkulturalitätsforschung. [...] Es werden u.a. Werke von Lenz, Klinger, Goethe und Schiller untersucht.
Redaktioneller Hinweis in „literaturkritik.de“ (September 2022)
|