Schörle, Eckart: Die Verhöflichung des Lachens
Artikel-Nr.: 978-3-89528-618-6
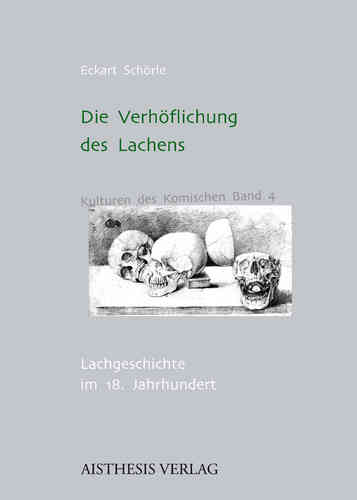
Die Fähigkeit zu lachen ist eine wesentliche Eigenschaft des Menschen und ein zentrales Element der Kommunikation. Lachen kann als gezieltes Mittel eingesetzt werden oder durch eine ungeplante Äußerung irritieren und provozieren. Aus diesem Grund war es immer auch Gegenstand gesellschaftlicher Reglementierung. Diese Untersuchung setzt voraus, dass nicht nur das, worüber wir lachen, sondern auch das Lachen selbst einer kulturellen Prägung unterliegt. Ausgehend von den Thesen Norbert Elias’ wird die Frage gestellt, ob auch das Lachen einen „Prozess der Zivilisation“, eine „Verhöflichung“ erfuhr.
Im Zentrum der Arbeit stehen die Diskussionen über das Lachen in der höfischen und der bürgerlichen Gesellschaft. Anhand der Anstands- und Höflichkeitsliteratur werden zunächst die Normierungen des Lachens erläutert. Ein genauer Blick auf die höfische Gesellschaft zeigt dann die vielseitigen Facetten der adeligen Lachkultur auf. Das bürgerliche Lachen konstituierte sich zwar in bewusster Abgrenzung zum höfischen Gelächter, setzte aber die Entwicklung einer „Verhöflichung des Lachens“ schließlich weiter fort.
| Daten |
Eckart Schörle Die Verhöflichung des Lachens Lachgeschichte im 18. Jahrhundert Kulturen des Komischen, Bd. 4 2007 ISBN 978-3-89528-618-6 418 Seiten, mit 12 Abbildungen kartoniert |
|---|---|
| Inhalt |
|
| Autoreninfo |
Eckart Schörle, Jg. 1971, studierte Geschichte, Politik und Philosophie in Gießen und Göttingen. 2005 promovierte er an der Universität Erfurt über die „Verhöflichung des Lachens“. Zurzeit arbeitet er als Lektor in Erfurt. |
| Lese-/Hörprobe |
Leseprobe: 9783895286186.pdf |
| Aus der Kritik |
[...] [D]iese [...] Arbeit [verdeutlicht] nicht nur in ihren unmittelbar dem Lachen im Theater gewidmeten Passagen, daß das Lachen als semiotisches und interaktives Geschehen, als eine mehr oder weniger sinnhafte Körperäußerung vor Publikum eine theatralische Angelegenheit ist. Zur interdisziplinären Erforschung des Lachens, an der nach Philosophen und Medizinern dann Biologen und Psychologen, Literaturwissenschaftler und Linguisten partizipiert haben, kann neben den anthropologisch ausgerichteten Historikern gerade die Theaterwissenschaft Erhebliches beitragen. Nicht nur die Geschichte der Komödie und des Lachtheaters im engeren Sinne stehen hier zur Debatte. Nahezu jede Szene des Lachens, von der Antike bis zum Alltag, läßt sich als theatralisches Spektakel, als eine Aufführung vor Publikum explizieren. |
| Reihe |
Kulturen des Komischen, Bd. 4 |
