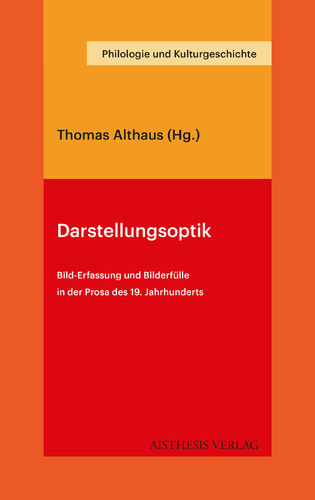In der Literatur zur Mitte des 19. Jahrhunderts dominiert ein Gestus des Zeigens, der Texte an Wahrnehmung koppelt. Das erinnert aber nur noch von fern an das alte Anschauungsparadigma einer ‚malenden Poesie‘. Die neue Intention auf Bilder hat viel mit den rasch sich entwickelnden Techniken der Visualisierung und der Illustration zu tun. Dahinter verbirgt sich jedoch ein immer nur ansatzweise aufzuhebendes Problem: die fehlende Sichtbarkeit der Moderne. Wo Texte jetzt Bilder evozieren, geht es um die Modellierung flüchtiger Blicke im Zeitalter der Beschleunigung, um den permanenten Wechsel von ‚Ansichten‘, um deren Transformation in diesen und jenen bleibenden Eindruck. Insbesondere die Journalprosa an der Schnittstelle literarischen und journalistischen Schreibens überbietet sich in „Genrebildern“, „Sittengemälden“, „Zeitbildern“, „Lebens- und Kulturbildern“, „Reisebildern“, „Skizzen“, unter welchen Titeln die Welt des 19. Jahrhunderts eine medienanaloge Ausformung erfährt.