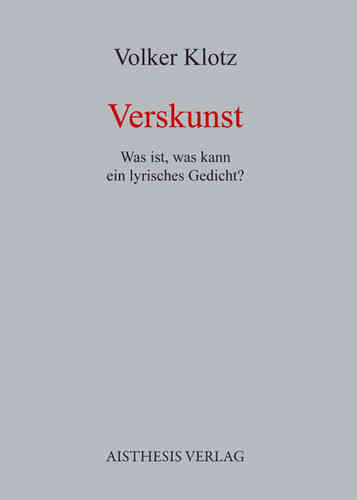| Aus der Kritik |
[...] Und [Volker Klotz] beschränkt das lyrische Gedicht letztlich auf das Gutenberg-Zeitalter, weil nur der gedruckte lyrische Text das Zugleich von stummer Gedicht-Lektüre und erklingender Gedicht-Rezitation ermöglicht, das Klotz "synästhetischen Vollzug" nennt. [...] Daher ist es konsequent, dass Klotz seine exemplarischen Interpretationen mit Gedichten aus dem 17. Jahrhundert beginnen und mit solchen aus dem zwanzigsten Jahrhundert enden lässt. [...] An jedem dieser Beispiele will er zeigen, dass das lyrische Gedicht auf raffinierte Weise den prosaischen Alltagsgebrauch der Sprache außer Kraft setzt, grammatische wie semantische Regeln verletzt, um jenen Raum zu schaffen, in dem die Sprache sich nur noch auf sich selbst bezieht [...].
Rolf Spinnler in "Stuttgarter Zeitung" (11.10.2011)
Herr Klotz, im Untertitel heißt Ihr Buch „Was kann ein lyrisches Gedicht?“. Was kann es?
Ohne es begründen zu müssen, kann ein Gedicht innerhalb seines selbst entworfenen minimalen Versraums die allergrößten Sprünge tun. Sprachlich kann es klingende Harmonien und Dissonanzen erzeugen zwischen vermeintlich unvereinbaren Ereignissen und Empfindungen.
Warum liest man Gedichte?
Vor allem um sich zu erholen von der trockenen Zweckmäßigkeit verschlissener Alltagsprosa. Und erst recht, um sich zu vergnügen an unvorhergesehenen sprachlichen Wendungen. Etwa an einem halsbrecherischen Zeilensprung plus Reim wie dem hier: „Madam Sauerbrot, die schein-/ Tot gewesen, tritt herein.“ Was Buschs komisch grotesker Verserzähler hier veranstaltet, das richten auch unkomische Lyriker immer wieder an mit verblüffender Wirkung. Sie kreuzen und mischen Unzusammenhängendes, wie die Alchimisten, aus disparaten Elementen. Und stoßen dabei, häufiger als jene, auf Gold. Daran hörend, lesend, schauend teilzunehmen ist die unersättliche Lust von Gedichtelesern. Früher wurde mehr auswendig gelernt. Kaum einer sagt heute noch Gedichte auf. Hemmen kann dabei mancherlei Schamhaftigkeit. Meine Altersgenossen und ich sind dereinst genötigt gewesen, in der Kirche und als NS-Pimpfe auf Kommando unverstandene Litaneien und überrhythmisierte Marschlieder zu singen.
Sie stellen sieben Merkmale für Lyrik fest. Wie kommen Sie auf diese Zahl?
Da ist gewiss eine Prise symbolistischen Schabernacks im Spiel. Es hätten auch acht sein können, doch sieben sind es mindestens. Erstens: Fabel-Los. Zweitens: Kurz und prägnant. Drittens gibt es ein allgegenwärtiges, allmächtiges lyrisches Ich. Viertens entwirft es in seinem Versraum extrem alltagswidrige Zeitverhältnisse. Und so fort.
Neben Lesungen sind die einzigen Orte für Gedichte die Verse, die in der Straßenbahn auf Zetteln über den Fenstern kleben.
Ich finde das gar nicht so übel. Dort stoßen Menschen auf Lyrik, die sonst vielleicht nie einen Gedichtband zu Hand nehmen. Außerdem denke man an den sprachspielerischen Magnetismus der tönenden Werbeslogans von früher: „Schreibste mir, schreibste ihr, schreibste auf MK-Papier.“ Auch politische Organisationen haben Gebrauchslyrik und Zweckgedichte benützt: „Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.“
Nach welchen Kriterien haben Sie die Gedichte ausgewählt?
Die Auswahl war letztlich willkürlich. Ich habe mehr für liedhafte Gedichte übrig. Mit Hölderlin und Schiller kann ich weniger anfangen als mit dem stark unterschätzten Mörike. Mörikes Lyrik ist menschenfreundlicher als jene solcher Postament-Lyriker. Als Schillers rhetorische Posaunen und Hölderlins überanstrengter Satzbau. Da ertönen Verkündigungen. Auch den Tiefschurf des späten Rilke möchte ich den Eingeweihten nicht streitig machen.
Hat ein Wissenschaftler ein Lieblingsgedicht?
Wie bei allen leidenschaftlichen Lesern kann es wechseln. Derzeit erfreut mich noch immer Brentanos „Wie sich auch die Zeit will wenden“. Und man liest lang, bis man so gut Gemachtes findet wie die Gedichte von Brecht.
(Aus einem Interview der „Stuttgarter Nachrichten“ vom 24.12.2011. Die Fragen stellte Nicole Golombek)
[…] Volker Klotz ist ein leidenschaftlicher Betrachter von Einzelfällen. Ihn beschäftigt nicht, was „die Lyrik“ ist, stattdessen fragt er, wie „ein lyrisches Gedicht“ beschaffen ist, und welche Wirkungen dieses – so und nicht anders verfasste – Gedicht auf den Leser ausüben kann. In seinen detailverliebten Analysen erweist sich Klotz als Meister des genauen Hinschauens und Hinhörens, dem jeder Zeilenbruch, jeder Reim, jede Assonanz beachtenswert ist. Bewusst vermeidet Klotz dabei den berühmt-berüchtigten Tiefsinn jener sogenannten „Interpreten“, die den Wortlaut eines Gedichts gering schätzen, weil sie nach dem „Sinn“ suchen, der sich angeblich „hinter“ den Worten verbirgt. Klotz ist nicht nur ein Freund der Einzelfälle, sondern auch ein Liebhaber des Wortlauts, der gründlich über den Wert einzelner Formulierungen nachdenkt. […]
Hermann Schlösser in „Wiener Zeitung“ (21./22.4.2012)
[…] Volker Klotz, der mit seiner Studie zum Großstadtroman der Moderne, die immerhin vor mehr als vierzig Jahren erschien, beständiger Bezugspunkt in der Literaturwissenschaft geblieben ist und auch in der Dramentheorie Bleibendes publiziert hat, legt nun mit „Verskunst“ eine gelehrte und belehrende Studie darüber vor, was Lyrik ist, soll und kann und wie man mit ihr umgeht. Und sie ist aller Ehren wert. Die Genauigkeit und Geduld, mit der Klotz jene teils robusten, teils fragilen sprachlichen Gebilde unter die Lupe nimmt, die in seinem Sinne als Lyrik firmieren, wäre schon in früheren Jahren anachronistisch gewesen. Zuneigung und Genauigkeit, aber auch der Wunsch, die Vielfalt der formalen Möglichkeiten zu verstehen, gehen dabei eine wunderbare Verbindung ein. Mit anderen Worten, man mag den Gedichten, die sich Klotz vornimmt, ebenso gern folgen wie seinen exegetischen Bemühungen. Ja, so kann mans machen, wenn man sich die Zeit nimmt und die Mühe machen will. Und wer sich für Literatur interessiert, sollte sich eben auch Mühe machen wollen. Dass es sich lohnt, weiß Klotz auf schönste Weise vorzuführen. […] Was könnte man also besseres über diese mehr als 300 Seiten intensive Lyrikarbeit sagen, als dass sie mit Vergnügen und Gewinn gelesen werden k[ann].
Walter Delabar in „literaturkritik.de“ (August 2012)
Die vollständige Rezension: http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=17055
[…] das Buch [enthält] […] eindringende und subtile Analysen, die lockere Schreibweise erhöht das Lektüre-Vergnügen.
Gunter E. Grimm „Germanistik“ (2011, Heft 3-4)
|