Lubrich, Oliver: Das Schwinden der Differenz
Artikel-Nr.: 978-3-89528-454-0
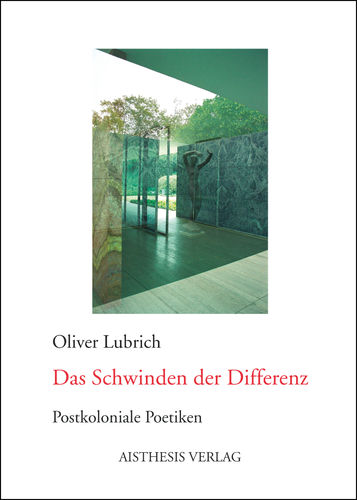
Wie beschreiben literarische Texte das Fremde? Diese zentrale Frage ‚postkolonialer‘ Literatur- und Kulturwissenschaft nach der Repräsentation von Alterität ist durch zwei weitere Fragen zu ergänzen: Welche Eigendynamik haben diese Inszenierungen? Und welche ästhetischen Konsequenzen? Die Auseinandersetzung moderner Literatur mit Andersheit (kulturell, sozial, geschlechtlich) ist nicht ideologisch geschlossen; sie lässt sich angemessener als dynamische Komplikation beschreiben: nicht allein als eine Konstruktion, sondern als ein „Schwinden der Differenz“. Und sie funktioniert nicht nur auf der thematischen Ebene, sondern auch poetologisch: in der literarischen Form. Als Fallbeispiele dienen vier Werke der literarischen Moderne, die Alterität in autobiographischen Genres anhand von Reisebewegungen konfigurieren: Alexander von Humboldts amerikanischer Reisebericht, Relation historique du Voyage aux Régions équinoxiales du Nouveau Continent (1814-1831), stellt in seiner Poetik die Möglichkeit, über den fremden Kontinent einen kohärenten Diskurs etablieren zu können, radikal in Zweifel. Bram Stokers Dracula (1897) beschreibt, wie der Vampir fiktional hervorgebracht, imaginär bekämpft und kulturell verunmöglicht wird. Ernst Jüngers In Stahlgewittern (1920) codiert den Krieg in bildlichen Sequenzen, deren Widersprüchlichkeit als Symptom einer Verunsicherung lesbar ist. Und Jean Genet schildert im Journal du voleur (1949), wie der Versuch, sich selbst als Aussenseiter der Gesellschaft zu definieren, in Aporien gerät.
| Daten |
Oliver Lubrich Das Schwinden der Differenz Postkoloniale Poetiken Alexander von Humboldt – Bram Stoker – Ernst Jünger – Jean Genet 2004 ISBN 978-3-89528-454-0 364 Seiten gebunden |
|---|---|
| Inhalt |
|
| Autoreninfo |
Oliver Lubrich, geboren 1970 in Berlin, studierte Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Berlin, Saint-Étienne und Berkeley. Er unterrichtet am Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft der Freien Universität Berlin. Übersetzung des Romans Los amigos y el viento von Virginia Grütter Jiménez (Ludwigsburg 1996). Kurator der Ausstellung Zeichen des Alltags – Jüdisches Leben in Deutschland heute (diverse Standorte in Deutschland und Österreich, 2000-2004). Publikationen zu Alexander von Humboldt, Dracula und James Bond, postkolonialer Museologie, jüdischen Studien und Shakespeare (Shakespeares Selbstdekonstruktion, Würzburg 2001). |
| Aus der Kritik |
Postkoloniale Theorie boomt. Die deutsche Literatur aber krankt an wenig repräsentativen Texten, die sich zur Analyse anböten. Das man diesen Mangel auch produktiv verstehen kann und Texte in den Blick rückt, sie gegen den Strich liest, die auf den ersten Blick kaum miteinander zu tun haben, erweist sich in Oliver Lubrichs Dissertationsschrift als Stärke. Anhand von vier äusserst dichten Lektüren von Alexander von Humboldts „Relation historique“ (1814ff.), Bram Stokers „Dracula“ (1897), Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“ (1920) und Jean Genets „Journal du voleur“ (1949) zeichnet Lubrich Alterität in autobiografischen Genres als poetologisches wie thematisches Gestaltungsmoment nach. |
